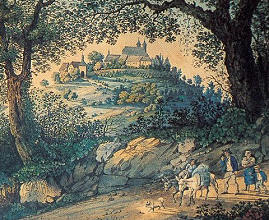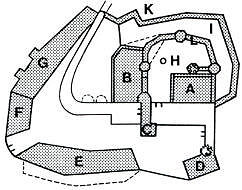|
|
|
Die Burg Dilsberg |
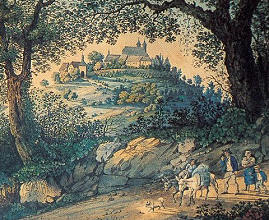
ca.1813 Gemälde Carl Philipp
Fohr 1795-1818 |
Seit 988 gehörte der Dilsberg als Teil der zum Forst erklärten
Wälder zwischen Neckar, Elsenz und Lein (Wimpfener Bannforst) dem Bistum Worms.
Die im Dienst des Königs und der Bischöfe von Worms stehenden Grafen von
Lauffen, welche im 11. Jahrhundert im Kraichgau Fuß fassten und dabei auch
einen alten Adelssitz in Wiesenbach zu ihrem Wohnsitz ausbauten, dürften sich
zunehmend für den bewaldeten Buntsandsteinkegel am Neckar interessiert haben.
Zwar bauten sie sich südlich des Wiesenbacher Oberdorfes auf dem Kühberg eine
Burg, die sie auch bis Mitte des 12. Jahrhunderts bewohnten, doch schien ihnen
wohl besonders wegen der verkehrsmäßigen Erschließung des Neckartales der
Dilsberg ein günstigerer Wohnsitz zu sein. So dürften sie vom Bischof von Worms,
der sicher an der herrschaftlichen Durchdringung der einsamen Waldgebiete
interessiert war, den Dilsberg als Eigengut erbeten und erhalten haben. Seit
Mitte des 12. Jahrhunderts ließen sie Teile des Berges roden und die Burg
errichten, zu deren ältesten Teilen die heute noch erhaltene mächtige
Schildmauer gehört.
|
|
|
Burgenbau auf den Höhen war
damals etwas Neues. König und Adel beteiligten sich daran. Die Burgen gaben dem
Land fortan das charakteristische, bis heute bewahrte Bild. Die Ritterburg ist
ein unverwechselbares Produkt des hohen Mittelalters. In sozialgeschichtlicher
Sicht ist der Burgenbau insofern interessant, als er den schon vorhandenen
Abstand zwischen Adel und bäuerlicher Bevölkerung vergrößerte und die
gesellschaftliche Kluft vertiefte, indem die an den Rändern der Dörfer gelegenen
Adelshöfe verlassen wurden.
Die Burg Dilsberg dürfte um 1200 fertig gewesen sein. Für
1208 ist sie schriftlich erstmals belegt.
(Quelle: Aus der Geschichte des Dilsberges -- Uffelmann/Wiltschko)
|
|
Die Burg und ihre Festungsanlage |

Aufnahme vor 1913 |
Sie überlebte unbeschädigt heiße Kämpfe, Eroberungen und Rückeroberungen.
Die Truppen Tillys konnten ihr ebenso wenig etwas antun wie die Melacs, auch französische Revolutionsheere mussten vor ihren starken Mauern weichen. Und
dennoch, die Burg Dilsberg präsentiert sich dem Besucher als Ruine. Die Dilsberger selbst waren es, die ihre Burg zerstörten. Der Grund: Die total
verarmte Bevölkerung (Anfang des 19. Jh.) brauchte Steine, um ihre
Wohnhäuser zu bauen. Und so wurde die Burg im Jahre 1826 zum Abbruch
freigegeben. In Resten blieb das alte, teilweise über 800- jährige Gemäuer
erhalten und lässt ahnen, welche Bedeutung der Burg in früheren Zeiten
zukam. |

Aufnahme vor 1913 |
|
| |
Plan der ursprünglichen
Burganlage
A Palas (Wohngebäude)
B Amtshaus
C Torgebäude mit Kerker
D Kommandantenhaus
E Stallungen
F Zehntscheuer
G Kaserne
H Innenhof
I Burggraben
K Außenmauer -
L Innere Mantelmauer |
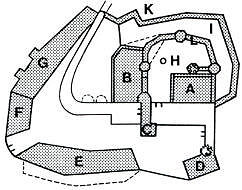 |
Die Burg ist deutlich in Vor- und
Hauptburg untergliedert. Zur Vorburg gehörte die Kaserne, spätere
Invalidenkaserne (heute größtenteils Garten), die Zehntscheuer, der
Marstall mit dem Fruchtspeicher und das - noch gut erhaltene -
Kommandantenhaus. |

Kommandantenhaus Aufn. 1985 |
|
| |

Flankierungsturm
Aufnahme 1911 |
Um in die Hauptburg zu gelangen, mussten erst zwei viereckige
Flankierungstürme, die sich in einer, die Hauptburg beschützenden Mauer
fortsetzen, passiert werden. Erst dann kam das Haupttor zur Burg. Im Hof der
Hauptburg lag der Palas (fürstliches Wohngebäude, Rittergebäude), ein Bau
mit drei Geschossen. Davon ist nur noch ein mächtiges Kellergewölbe
erhalten, das sich als Veranstaltungsort für kleinere Konzerte
geradezu anbietet und ein sechseckiger Treppenturm. |

Kellergewölbe des Palas
Aufnahme 1912 |
|
| |

Mantelmauer Aufnahme 1913 |

Aufnahme 1911 |
Und wer den wundervollen Blick
von der gewaltigen Mantelmauer in das Neckartal nicht versäumen will, der
muss durch diesen Treppenturm steigen, um dann über einen hölzernen Steg auf
die 16 Meter hohe Ringmauer zu kommen. Ehemals umschloss sie die ganze
Hauptburg. Während sie nach Osten und Süden größtenteils zerstört wurde,
erhebt sie sich um so gewaltiger nach den anderen Seiten hin. Gut sichtbar
noch der Wehrgang, einst verstärkt durch drei Ecktürmchen an den
Knickstellen.
|
|
| |
|

 |
|
Nur noch alte Stiche und Gemälde geben heute Zeugnis von der einstigen
Schönheit dieser gesamten Anlage. Aber die vielen Besucher des Dilsberges
kommen nicht nur wegen der einmaligen Lage des Ortes, sondern auch - oder
gerade - wegen der Burgruine, welche die Silhouette des Bergkegels bestimmt.
|
Quelle: Die Bergfeste
Dilsberg - Stefan Wiltschko
Bilder: Bildindex der Kunst und Architektur des Bildarchivs Foto Marburg |